Markus Brozio:
"Anwendung des Dualen Entwurfs auf die Entwicklung eines robotergesteuerten
3D-Nähsystems" (Auszug)
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
Die deutsche Textil- und Bekleidungsindustrie einschließlich der Betriebsmittelherstellung befindet sich bereits seit geraumer Zeit in einem Zustand des kontinuierlichen Arbeitsplatzabbaus mit einhergehender Standortverlagerung insbesondere bei der Bekleidungsherstellung. Die Produktion von Haus- und Heimtextilien hingegen ist stabil und bei der Industrie für technische Textilien handelt es sich um eine Wachstumsbranche. Der deutsche Textilmaschinenbau hat am Weltmarkt einen Anteil von 30 - 35 % und ist somit führend. Trotzdem gibt es auch hier in einzelnen Branchen, z. B. bei der Herstellung von Nähmaschinen, rückläufige Umsätze und einen internationalen Verdrängungswettbewerb.
Bereits seit Jahrzehnten läßt die deutsche Bekleidungsindustrie im Ausland fertigen. Dies erfolgt entweder in eigenen Produktionsstätten oder unter Einbeziehung von Vermittlern. Daraus ergeben sich unmittelbare Auswirkungen auf die vorgelagerte Textilindustrie, da die Flächenherstellung häufig ebenfalls nicht mehr in Deutschland stattfindet. Statt dessen erfolgt sie in Ländern, die diese Technologie beherrschen, z. B. Indien, die dann wiederum direkt die Nähereien z. B. in Pakistan oder Sri Lanka beliefern. In Deutschland verblieben sind bei der Bekleidungsherstellung bis auf wenige Ausnahmen nur die Musterfertigung sowie Nachlieferungen, die innerhalb weniger Tage zur Verfügung stehen müssen. Auch die Fertigung teurer modischer Textilien ist in Deutschland verblieben.
In der nähenden Industrie sind sowohl die Nähmaschinenhersteller als auch die nähenden Betriebe in Länder mit niedrigen Lohnkosten abgewandert. Ein Gegentrend dazu ist die Tatsache, daß in einigen Branchen wie der Automobilzulieferindustrie das Interesse wächst, technische Textilien in Deutschland zu produzieren. Als Beispiel kann die Einkaufsstrategie der Automobilhersteller herangezogen werden, die komplette Sitze von Systemherstellern beziehen. Die Zulieferung des in räumlicher Nähe des Automobilherstellers angesiedelten Systemherstellers erfolgt zur Vermeidung einer Lagerhaltung direkt an das Fließband der Automobilwerks. Die Fertigung der Sitzbezüge erfolgt jedoch bisher ähnlich wie die Bekleidungsfertigung im Ausland, woraus erhebliche logistische Probleme resultieren. Schließlich muß der Sitzbezug genau zu dem richtigen Auto passen, wobei die Vormeldezeit bzw. verbindliche Bestellung der Automobilhersteller sehr kurz ist. Daraus resultiert der Wunsch des Systemlieferanten nach einer vollständigen Eigenfertigung des Sitzes, um so eine gefährliche Abhängigkeit vom Zulieferer zu vermeiden.
Zur Verlangsamung des Arbeitsplatzabbaus in Deutschland und zur Stärkung des Textilmaschinenbaus müssen in Deutschland völlig neue Wege gegangen werden. Ein zentraler ist das Integrierte 3D-Nähsystem, in dessen Mittelpunkt die 3D-Nähzelle steht. Drei Neuerungen charakterisieren das System:
- Das Werkstück, z. B. der Rock, ist fest aufgespannt, und die Nähmaschine wird mit einem herkömmlichen Industrieroboter an den Nahtbahnen entlanggeführt. Diese Vorgehensweise ist genau entgegengesetzt der bisherigen, bei der eine Näherin das Werkstück entlang der feststehenden Nadel führt.
- Das spätere dreidimensionale Produkt wird bereits im dreidimensionalen Zustand an einem Formkörper genäht. Hierdurch entfallen die Probleme, die entstehen, wenn ein räumlicher Körper in einem zweidimensionalen Nähvorgang hergestellt werden soll.
- Die Positionierung auf dem Formkörper erfolgt rechnerüberwacht ohne menschlichen Eingriff, d. h. Maschinen sind zuverlässig in der Lage, biegeschlaffe Materialen präzise und sicher ohne Beschädigung zu greifen, zu transportieren und zu adaptieren.
Diese Neuerungen sind in der nähenden Industrie ohne Vorbild und können in ihrer Bedeutung mit der Einführung des Roboters in der Automobilfertigung zu Beginn der 70er Jahre verglichen werden.
Zur Nutzung aller Vorteile der 3D-Nähzelle ist ihre Einbindung in ein Gesamtsystem erforderlich, das die vorlaufenden Tätigkeiten vom Zuschnitt an und die nachlaufenden Tätigkeiten bis zum Versand umfaßt. Dies bedingt weitere Entwicklungen, wie einen leistungsfähigen Einzellagenzuschnitt und ein Transportsystem mit automatischen Greifeinrichtungen.
Ergebnis ist ein Fertigungssystem, das Textilien in höchster Qualität, mit genauer Paßform und innerhalb einer Grundform auch sehr flexibel fertigen kann. Hierdurch ergeben sich neue Möglichkeiten für die gesamte textile Kette, beginnend beim Rohstoff, der Garn- und Flächenherstellung, der Veredelung und der Konfektion bis hin zum Vertrieb. Ebenso müssen die Textilmaschinenhersteller, z. B. zur Vermarktung Integrierter 3D-Nähsysteme, eingebunden werden. Der hochentwickelte deutsche Textilmaschinenbau kann das Konzept marktreif machen und dabei auch den Textilmaschinenbau langfristig stabilisieren.
Ziel dieser Arbeit ist die Reflexion des Entwicklungsprozesses im Hinblick auf den notwendigen bzw. möglichen Automatisierungsgrad. Daraus ist eine Empfehlung für weitere Entwicklungsschritte des Integrierten 3D-Nähsystems mit den speziellen Zielen "Qualität" und "Flexibilität" abzuleiten. Dabei ist die Methode des Dualen Entwurfs anzuwenden, und die zeitlichen und finanziellen Ressourcen sind zu beachten. Schließlich sind Perspektiven für die deutsche Textil- und Bekleidungsindustrie sowie die Betriebsmittelhersteller aufzuzeigen.
1.2 Vorgehensweise
Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen des Verbundprojekts Integriertes 3D-Nähsystem, das vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie innerhalb des Programms "Produktion 2000 - Strategien für die Produktion im 21. Jahrhundert" gefördert wurde. In dem von Oktober 1995 bis Dezember 1999 durchgeführten Projekt entwickelten mehr als 15 deutsche Forschungsinstitute und Unternehmen der textilen Kette 3D-Nähsysteme zur Fertigung eines körperbetonten Damenrocks bzw. eines Autositzes. Zum Projektabschluß konnten die fertig entwickelten, erprobten und aufeinander abgestimmten Teilsysteme der Bekleidungslinie der öffentlichkeit vorgestellt werden. Die bereits fertig geplante Integration zum Gesamtsystem am vorgesehenen Standort in Deutschland scheiterte jedoch aus verschiedenen Gründen. Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag zur Umsetzung leisten.
Es ergibt sich für die Arbeit die in Bild 1-1 dargestellte Vorgehensweise. Das Bild zeigt die unterschiedlichen Systemgrenzen, beginnend bei der textilen Kette speziell in der Bundesrepublik Deutschland und endend bei dem Nähroboter des Integrierten 3D-Nähsystems. Darin eingetragen sind der Aufbau und die zugehörigen Kapitel der vorliegenden Arbeit. Die beiden Pfeile zeigen die prinzipielle Vorgehensweise, die vom Allgemeinen (Ausgangslage der Branche) ausgehend hin zum Speziellen (Nähroboter) wieder zum Allgemeinen (Perspektive der Branche) führt.
Die Ausgangslage zu Beginn der Projektlaufzeit wird durch die zahlenmäßige Entwicklung der deutschen Textil- und Bekleidungsbranche einschließlich der Betriebsmittelhersteller seit der deutschen Vereinigung in Kapitel 2 beschrieben. Eine erste Einschränkung des Themengebiets erfolgt durch einen Blick auf die Oberbekleidung, speziell die Damenröcke, die Jacken bzw. Sakkos sowie die Anzüge bzw. Kostüme.
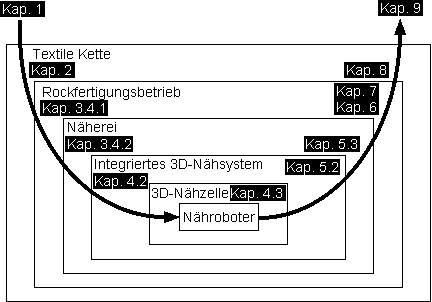
Bild 1-1: Aufbau der Arbeit
Aus diesen Fakten wird in Kapitel 3 die Notwendigkeit für die Entwicklung eines 3D-Nähroboters hergeleitet. Dies erfolgt, indem zunächst das Innovationsfeld "Textile Kette" betrachtet wird, bevor eine Ist-Analyse der derzeitigen Fertigung in der Bekleidungsindustrie erfolgt.
Zur Findung des optimalen Automatisierungsgrades wird in Kapitel 4 die Methode des Dualen Entwurfs eingeführt, die in Kapitel 4.2 als Reflexionsinstrument angewendet wird. Hier werden die im Projektverlauf entwickelten Varianten des Integrierten 3D-Nähsystems beleuchtet und anhand der 3D-Nähzelle wird die praktische Anwendung der ausgewählten Methode gezeigt (Kapitel 4.3). Die Beschreibung der gefundenen und realisierten Lösungen der Einzelsysteme der Nähzelle und des Integrierten 3D-Nähsystems erfolgt im anschließenden Kapitel 5.
Die Zielgrößen Qualität und Flexibilität werden in den folgenden eng verzahnten Kapiteln 6 und 7 behandelt. Dabei werden zunächst die Problembereiche herausgearbeitet, bevor technischen Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Die Diskussion der qualitäts- bzw. flexibilitätsrelevanten Aspekte im Gesamtsystem führt jeweils zu einer abschließenden Bewertung.
Die Perspektiven für den industriellen Einsatz der 3D-Nähtechnik (Kapitel 8) basieren auf den Entwicklungen im Innovationsfeld "Textile Kette" (Kapitel 3.2), den Ergebnissen aus den Kapiteln 6 und 1 sowie auf Veränderungen im gesellschaftlichen Umfeld, die in Kapitel 8.2 herausgearbeitet werden. Der Ausblick in Kapitel 9 behandelt schwerpunktmäßig die Auswirkungen auf die Arbeitsplätze in zukünftigen Integrierten 3D-Nähsystemen, wobei als Bewertungsinstrument die Methode des Erweiterten Dualen Entwurfs, die auf dem Dualen Entwurf (Kapitel 4) basiert, zur Anwendung kommt. Zusätzlich wird ein kurzer Ausblick für die gesamte Branche vorgenommen.